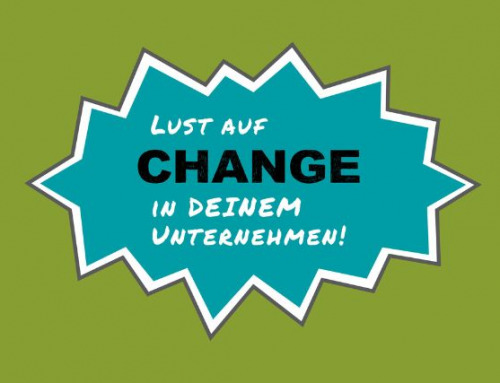Berichte
25. Januar 2024
Von der (Berichts-)Pflicht zur Kür

v.l.n.r: Volker Schmidt-Sköries (Bäckerei biokaiser), Jochen Müller (cramer müller & partner), Christiane Hütte (Hotel Villa Orange), Daniel Anthes (Brauerei Knärzje)
Podiumsdiskussion in der Villa Orange: Drei Bio-Pioniere teilen ihre Erfahrungen mit dem Nachhaltigkeits-Reporting
Eine spannende Podiumsdiskussion zum Thema „Nachhaltigkeits-Reporting“. Nachhaltigkeitsberater Jochen Müller, brachte zunächst die Zuhörenden auf den aktuellen Stand der Berichtspflichten und gesetzlichen Vorgaben. CSRD, EU-Taxonomie und Lieferkettengesetz sind die Richtlinien der Stunde. Angesichts der Vielzahl der rechtlichen Rahmenbedingungen ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Was kommt wann auf die mittelständischen Unternehmen zu? Und wie ordnet sich die Gemeinwohl-Bilanz in diese Berichtspflichten ein? Vieles sei im Fluss, weiß Müller. Deshalb wolle die GWÖ mit den drei Unternehmer*innen auf dem Podium Mut machen, die positiven Aspekte und den eigentlichen Zweck der Transformation nicht aus den Augen zu verlieren.
Drei Bio-Pioniere auf dem Podium
Schon bei der Vorstellung wird den Zuhörenden klar, dass hier drei Unternehmer*innen aus Überzeugung handeln und auch im Prozess der Berichterstattung bereits weit vorangeschritten sind.
So stellte Christiane Hütte bereits 2008 ihr Hotel Villa Orange auf Bio um. „Was zunächst hart war“, denn sie musste sich von allen Lieferanten trennen und neue suchen. Es folgen der Beitritt bei den Bio-Hoteliers und die konsequente Ausweitung der Nachhaltigkeitsaktivitäten. 2019 veröffentlicht sie die erste Gemeinwohl-Bilanz und befindet sich derzeit im Re-Bilanzierungsprozess.
Volker Schmidt-Sköries (Bäckerei biokaiser) backt seit 1977 „richtig gutes Brot“ und will mit seinem Unternehmen „die Welt ein bisschen besser“ machen. Gegründet als Kollektiv in der Spontibewegung zeichnet sich die Bäckerei durch eine ökologische, soziale und ethische Unternehmensführung aus. Auch er hat schon eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt.
Bleibt bei biokaiser Brot übrig, landet es nicht in der Tonne, sondern bei Knärzje. Das Start-Up-Unternehmen braut aus altbackenem Brot ein Bier und setzt damit ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung. Daniel Anthes brachte diese Idee 2019 „mit dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun“, ins Rollen.
Doch was bringt nachhaltiges Handeln im täglichen Business?
Die Diskussion beleuchtete, wie nachhaltiges Handeln im täglichen Geschäft positive Effekte auf die Mitarbeitergewinnung hat. Findet ein nachhaltiges Unternehmen leichter Personal“, will Moderator Jochen Müller wissen. „Ja“, lautet die einhellige Antwort. Christiane Hütte berichtet, auf teure Stellenanzeigen verzichten zu können, da die Mitarbeitende das Unternehmen aktiv empfehlen. Ein Satz wie „komm doch zu uns, hier stimmen die Bezahlung und der Teamgeist“, wirke mehr als jede Anzeige. Bei den Bewerbungen für die Rezeption spiele es außerdem eine große Rolle, dass die Villa Orange Frankfurts einziges Biohotel sei.
Auch bei Daniel Anthes landen viele Bewerbungen im Mail-Account. „Die Strahlkraft von Knärzje ist groß“, freut er sich, „meine Herausforderung liegt eher darin, aus den vielen Bewerbungen die passenden herauszufiltern.“ Und bei biokaiser macht sich Volker Schmidt-Sköries keine Sorgen um den Bäcker-Nachwuchs: „Wir beschäftigen pro Jahr zwischen 30 und 40 Azubis und 62 Prozent unserer 370-köpfigen Belegschaft sind unter 40 Jahre alt.“ Gutes
Personal für den Verkauf sei schwieriger zu finden, räumt er ein. Doch das hindert ihn nicht daran, zu expandieren. In den kommenden Jahren sollen zehn neue Filialen eröffnet werden.
Müller fasst zusammen: „Alle Unternehmen haben keine Probleme genügend Bewerbungen zu bekommen. “Wer als Lieferant Fragen zur Nachhaltigkeit beantworten kann, ist im VorteilEin weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Lieferkette. Jedes Unternehmen ist Teil einer Wertschöpfungskette – auch kleine und mi lere Unternehmen, die nicht unter die CSRD-Richtlinie fallen, werden damit konfrontiert. Christiane Hütte berichtet, dass sie 2023 erstmals von einem großen Unternehmen und einer Filmproduktion gebeten, ihre Nachhaltigkeitsstrategie, CO2-Werte und Zertifikate offenzulegen. Dank bereits vorhandener Unterlagen für Bio Hotel-Prüfungen und Gemeinwohlbilanzen war dies problemlos möglich. Dies verschaffe ihrem Unternehmen nicht nur einen klaren Wettbewerbsvorteil, sondern änderte auch den Tonfall der Kommunikation und ermöglichte Verhandlungen auf Augenhöhe über Zahlungsziele.
Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal
Daniel Anthes lässt die Umweltauswirkungen einer Flasche Bier von Eaternety und dem Thünen Institut analysieren. Bei Gesprächen mit großen Einzelhandelsunternehmen hilft der Eaternity-Score dem Start-up Knärze, sich klar zu positonieren. Dan Antes betont aber auch: „Draußen wissen viele noch nicht Bescheid“, deshalb sei es enorm wichtig über die eigene Bubble hinaus zu kommunizieren und den Spagat zwischen „einfach“ und „fundiert“
hinzubekommen.
Die Lieferkette besteht in erster Linie aus Menschen Für Volker Sköries steht bei der Frage nach der Lieferkette nicht das Zetifikat im Vordergrund, sondern die Partnerschaft mit den Korn-Bauern. „Bio als bloßes Geschäftsmodell wäre nichts für uns“, sagt er und betont die Bedeutung zwischenmenschlicher Verbindungen. Sköries sucht gemeinsam mit den Bioland-Korn-Landwirten nach Lösungen, sei es bei Preisen oder der Planung einer Biogas-Anlage. Vertrauen entstehe nur, wenn man Schwächen benenne und „über die Dinge spricht, die noch nicht perfekt sind“, so seine Erfahrung.
Diese Haltung findet auf dem Podium und bei den Zuhörern viel Zuspruch, da sie die Essenz des Nachhaltigkeitsreportings widerspiegelt: Risiken erkennen, gemeinsam managen und mit offener Kommunikation begleiten.
Es entspinnt sich eine lebhafte Diskussion. Doch wie schafft man das? Hemmt die Bürokratie nicht die Innovation? Jochen Müller gibt folgende Empfehlung: Die Herausforderungen der Berichterstattung geht man am besten mit diesen 5 Schritten an:
- Die großen Hebel analysieren
- Die 1200 Datenpunkte der CSRD-Richtlinie auf die wesentlichen reduzieren
- Eine Klimabilanz erstellen
- Mit der Gemeinwohlbilanz die Stakeholder gesamtheitlich betrachten
- Ehrlich und proaktiv kommunizieren