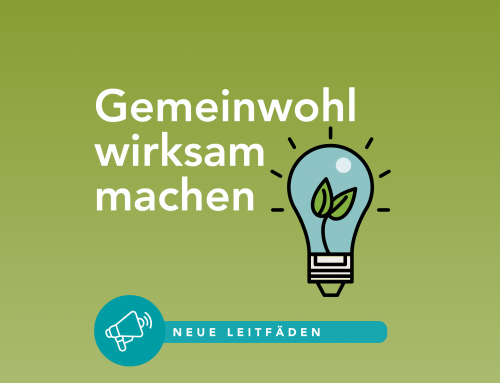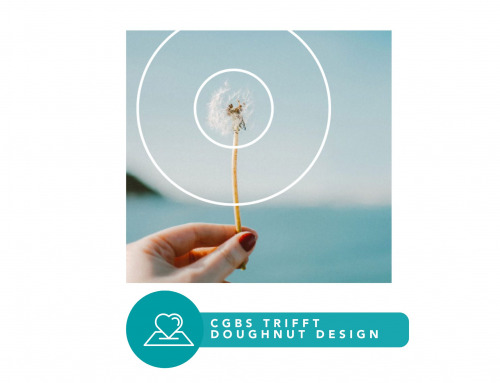Die Circular Economy und das Gemeinwohl
Vortrag und Diskussion an der TU Clausthal mit Christian Felber

Im Rahmen der 250-Jahresfeier der Technischen Universität Clausthal (TUC) hielt Christian Felber, Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie, am 18. Juni 2025 einen Vortrag mit dem Titel „Die Circular Economy und das Gemeinwohl“. Im Anschluss folgte eine Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Daniel Goldmann (TUC), Christian Felber, Dr. Jacob Wehrle (Fa. REMONDIS Recycling), Prof. Dr. Fabian Paetzel (TUC) und Prof. Dr. Ani Melkonyan-Gottschalk (TUC). Die Diskussion wurde von Prof. Dr. Roland Menges (TUC) moderiert. Die eineinhalbstündige Veranstaltung mit etwa 100 Gästen wurde aufgezeichnet (siehe unten).
Ökonomie – eine wertfreie Naturwissenschaft?
Einleitend erinnerte Felber an Adam Smith, der zum Zeitpunkt der TUC-Gründung (1775) die Wirtschaftswissenschaft als der Moralphilosophie zugeordnete Politische Ökonomie begründete. Felber: „Der Mann war Ethiker; von dorther kommt die Wirtschaftswissenschaft, auch wenn das heute nicht mehr allen so geläufig und vertraut ist!“ In Smith‘ Buch „Die Theorie der ethischen Gefühle“, so erinnerte Felber süffisant, überschrieb er Kapitel mit „Universelles Wohlwollen“ und „Zartfühlende Achtsamkeit“. Später noch hätte John Maynard Keynes gesagt, Ökonomie sei im Wesentlichen eine normative Wissenschaft.
Seit Milliarden Jahren kein Gramm Abfall
Ein vorbildlicher Ökologe aus Brasilien, José Luxemberger, der sich mit der Zerstörung der Regenwälder befasst hat, hätte gesagt: „Die Natur ist ein unglaublich riesiger Stoffwechsel, aber seit Milliarden Jahren wird kein Gramm Abfall produziert. Die perfekte Kreislaufwirtschaft!“ Der Begriff Abfall oder Emission oder Abwasser sei unbekannt. Da müsse doch eine gesunde Ökonomie auf einer Ökologie basieren, also eine ökologische Ökonomik sein. Felber: „Eigentlich müsste es doch so sein, dass ein neues Produkt nur dann zum Markt zugelassen wird, wenn es restlos wieder in die ökologischen Kreisläufe eingliederbar ist. Manche mögen jetzt denken, dass sei Utopie und technisch nicht machbar. Aber vor der Industriellen Revolution war das Standard, da gab es nur 100 % abbaubare Produkte.“ Jetzt hingegen gelte es beinahe als Sensation, wenn ein Haus komplett aus wiederverwendbaren Materialien gebaut wird.
Unsere Wirtschaft, eine „Wohlstands-Zerstörerin“?
Nach Meinung der Bevölkerung zerstöre die derzeitige Wirtschaftsweise laut einer Umfrage mittlerweile mehr Wohlstand als sie schaffe. Wir hätten im Jahre 2020 bereits vier von neun und mittlerweile seien bereits sechs von neun planetarischen Grenzen überschritten. Davon gelten die Klima-Erwärmung und der Verlust der Artenvielfalt als am bedrohlichsten. Felber zitiert Klaus Dierksmeier: „Von Aristoteles über Thomas von Aquin bis zu einschließlich Adam Smith bestand Konsens darüber, dass die ökonomische Theorie und Praxis sowohl legitimiert als auch begrenzt werden müssten durch ein übergeordnetes Ziel, wie etwa das Gemeinwohl.“
Die Verkehrung von Mittel und Ziel – ein wissenschaftlicher Fehler, den Mainstream-Ökonomen einfach durchwinken
Wirtschaftliche Aktivitäten sollten demnach ganz grundsätzlich auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Geld und Kapital hingegen sollten vernünftigerweise nur die Mittel des Wirtschaftens sein, aber nie der Zweck. Wie komme es nun, dass stattdessen der Schutz und die Mehrung von Kapital zum Zweck des Wirtschaftens gemacht wird? Schließlich stehe in keiner einzigen Verfassung der Welt: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalakkmulation“, also der Anhäufung von Geld oder Kapital.
Im Zweifel pro Kapital
Zwar würde das nicht heißen, dass es keine Menschenwürde, keine Nachhaltigkeit oder keine Ethik im Kapitalismus gäbe. Es könne aber bedeuten, dass im Zweifelsfall der Schutz und die Mehrung des Kapitals für wichtiger betrachtet wird, als die Werte in den Verfassungen. So hätten wir in den letzten Jahrzehnten den wirtschaftlichen Erfolg nicht an der Zielerreichung gemessen, obwohl man gar keine Wissenschaft dafür bräuchte, um zu wissen, dass man vernünftigerweise in allen Lebensbereichen den Erfolg zu allererst an der Erreichung der Ziele misst. (Nebenbei bemerkt, sollte es nicht verwundern, dass sich bei so manchem erfolgreichen Geschäftsmenschen die Sinnfrage seines Tuns einstellt.)
Felber findet es schließlich „kurios, aber bezeichnend“, dass sich die Wirtschaftswissenschaft dieser Einsicht größtenteils entgegenstellt und nach wie vor diese Mittel-Ziel-Verkehrung lehrt. Auf seine Weise macht Felber deutlich, was kapitalismuskritische Bewegungen schon immer erreichen wollen, nämlich die Logik der Kapitalverwertung als eine die gesamte Gesellschaft, Hirn und Herz, Mensch und Natur konterkarierende Entscheidungspraxis zu „entlarven“.
Was folgt?
Folgt nun eine Revolution in den Wirtschaftswissenschaften aus diesen grundlegenden Einsichten, vorgetragen in der Festaula einer Hochschule, dass diese Art zu wirtschaften keine Ökonomie im klassischen Sinne sei, sondern die Kunst des Sich-Bereicherns? Man urteile selbst, wie eine ökonomisch versierte, akademische Zuhörerschaft, diese geistige Kost verdaut, – ignorierend, empört widersprechend oder zustimmend: https://video.tu-clausthal.de/videoserie/1457.html

Ninja Borchert, Claudia Hasert, Prof. Dr. Menges, Christian Felber